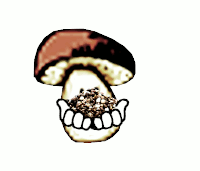Beiträge von Lucky
-
-
 Naja, immerhin hat das einst der Andreas geschrieben, aktuell Mitglied des Präsidiums der DGfM, Lehrgangsanbieter und PSV-Prüfer.
Naja, immerhin hat das einst der Andreas geschrieben, aktuell Mitglied des Präsidiums der DGfM, Lehrgangsanbieter und PSV-Prüfer.Also, als "völligen Unsinn" würde ich das nicht bezeichnen.
LG, Nobi
Hi Nobi
Welche juristische Ausbildung hat er?
Vom Vorstandchef der Daimler AG würde ich mir auch nicht meine Bremsen am Auto reparieren lassen.

VG Jo
-
Hi Nobi,
an den Haaren herbeigezogen und völliger Unsinn.
VG Jo
-
Hi Björn,
Lophodermium pinastri ist doch bei der Helvella leucomelaena mit dabei.
 Desmazierella - kann man nicht so gut sehen - war auf eine fast schwarze Kiefernadel, auch nur die 2 Fruchtkörper. Bei der Nässe im Moment hast Du bestimmt gut Chancen sie zu finden.
Desmazierella - kann man nicht so gut sehen - war auf eine fast schwarze Kiefernadel, auch nur die 2 Fruchtkörper. Bei der Nässe im Moment hast Du bestimmt gut Chancen sie zu finden.VG Jo
-
-
Hi Hilmgrid,
Danke. aber Kalkgebiete gibt es bei uns am Niederrhein leider nicht.

VG Jo
-
Hi zusammen,
langsam lohnt es sich wieder Touren zu machen.
Eigentlich Ausschau gehalten nach etwas anderen, aber mit Haare auf dem Hymenium hat auch etwas.
Desmazierella acicola Kiefernnadel-Haarbecherchen.
Etwa 90% der Kartierungen bei Mykis sind von einer Person. Auch an Fichtennadel zu schauen könnte sich lohnen, der zweite Vertreter der Gattung hatte ich nicht das Glück zu finden - Desmazierella piceicola. Da stammen 100% der Kartierungen vom fleißigen Herrn in Brandenburg.
Weswegen ich in dem Wald war haben ich dann doch gefunden, leider den etwas feuchten Schwarzmündiger Kelchbecherling Plectania melastoma. Irgendwann erwische ich ihn noch in komplett Orange.
Dazu gabe es in dem Kiefernwäldchen noch 100erte Helvella leucomelaena, wo ich dann doch eine schwärzlichen - passend zu deutsche Namen Schwarzweiße Rippen-Becherlorchel - fotografiert habe.
Auch der Winterstielbovist (Tulostoma brumale) sah noch gut aus.
Beim Johannesbeerenstrauß lohnt es sich nicht nur im Sommer vorbei zu schauen, den gerade da findet man Godronia ribis (Johannisbeer-Becherling) nicht.
Auch passendes zur roten Johannesbeere zeigten sich auch Nectria ribis wie ich zuerst dachte... Aber wohl leider ein Fall für eine DNA-Analyse, wie Karl Wehr herausgefunden hat.
" ARTEN AUSGESCHLOSSEN ODER MIT UNKLAREM STATUS Anmerkungen: Nectria cinnabarina var. ribis wurde ursprünglich beschrieben
als Sphaeria ribis von Tode (1791) beschrieben. Da die Exemplare von Tode
zerstört wurden (Kirk et al. 2008), werden seine Abbildungen als
als Lectotypus angesehen (Tabula XII, Abb. 103a-f). Tode (1791) beschrieb und
und illustrierte glatte, birnenförmige Perithecien, die an der Basis eines
einem gut entwickelten Stroma, möglicherweise als Parasit, und gehören daher nicht
in den N. cinnabarina-Artenkomplex gehören. Vielmehr scheint sie
mit Cosmospora verwandt zu sein.
Übersetzt mit DeepL Übersetzer - DeepL Translate (kostenlose Version)"
Ansonsten scheint Ribis noch einiges zu bieten.
Bei nicht bestimmbar - eine "flache Lorchel", leider noch ohne Sporen im Fichtenwald, aber immerhin sie sind da.

Dazu gab es noch Gymnopus perforans Nadel-Stinkschwindling. Die anderen Lamellenpilze, wie z.B.Rauchblättrige Schwefelkopf (Hypholoma capnoides) oder Tintlinge aus Domestic-Gruppe waren nicht gerade fotogen, aber wenigstens vorhanden.
Auf dem Rückweg noch Neodasyscypha cerina Wachsgelbes Haarbecherchen
Zum Schluß, bei den ganzen Winterpilzen, dann nochmal nachgesehen was Dendrostilbella smaragdina macht. So spät im Jahr hatte ich sie noch nicht, aber waren da. Fotografiert habe ich sie heute nicht, aber im Dezember mal eine Test durch Mikroskope mit 200er Vergrößerung - ist noch ausbaufähig...
VG Jo
-
Hi Bernd,
Bei Juristen sind keine Biologen und ob es der Pharagraf nach1969 geändert würde entzieht sich meiner Kenntnis.

Eine Bundesländer sind da weiter bzw neuer
BbgNatSchG
Abschnitt 10
Ordnungswidrigkeiten§ 73
Verstöße gegen Bestimmungen des Naturschutzgesetzes16.
Wild lebende Blumen, Gräser, Farne und Teile von Gehölzen dürfen aus der Natur außerhalb des Waldes an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, für den persönlichen Bedarf entnommen werden, sofern die betreffenden Pflanzen nicht zu den nach Bundesrecht besonders geschützten Arten gehören. Entsprechendes gilt für das Entfernen von Pilzen, Kräutern, Moosen, Beeren oder anderen Wildfrüchten. Das gewerbsmäßige Sammeln bedarf des Einverständnisses des Eigentümers und ist bei der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. Bei einer Gefährdung der Bestände oder des Naturhaushalts kann die untere Naturschutzbehörde das Sammeln und die Entnahme gebiets- und zeitweise untersagen.
Dein "vernüftige Gründe" zur Begründung mehr zu sammeln, ist leider juristisch nicht haltbar ( siehe Absatz 3), sondern betreffen wissenschaftliche Arbeiten oder ähnliches zum Erfassung , Untersuchung, etc.

VG Jo -
Hi Emil
"Handstraußgesetz" gilt für alle Arten
BNatSchG§ 39
1) Es ist verboten,
Absatz 1 (2)
wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,
(3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.
Ob es 1 oder 2 Kilo sind regeln die einzelnen Gemeiden.
VG Jo
-
Hi Mathias,
da ich deine Sporen auch vor 14 Tagen hat, habe ich den sehr guten Thread hier gefunden. Vielleicht hilft er dir weiter.
Sphaeropsis sapinea an Kieferzapfen
VG Jo
-
Hi Phillip,
besonders geschützt Speisepilzarten dürfen natürlich auch nicht im Privatwald gesammelt werden - auch nicht vom Besitzer.
Außerdem ist es nicht automatisch in jedem Naturschutzgebiet verboten Pilze zu sammeln. Es kann in der Schutzgebietsverordnung erlaubt werden.

VG Jo
-
Alles anzeigen
Hallo Jo
Das ist aber spannend... Ludwig schrieb 2001 noch, dass sein Fund vermutlich der erste gesicherte Nachweis in Deutschland sei.
Kann es sein, dass die Art vorher einfach konsequent falsch bestimmt wurde, weil sie in den meisten Büchern fehlte?
Gruss Raphael
Hi Raphael
Jep, die Diskussion hatten wir im Herbst auch schon, dass sie zu oft von oben schon als ausgeblaste R. fibula bestimmt wird. Karl Wehr hat sich als erster bei uns im Verein mit R. mellea beschäftigt.
VG Jo
-
Alles anzeigen
Hi,
danke für die interessanten Ergänzungen. Gut, wenn ich mal wieder eine stark ausgeblasste R. fibula im Sachsenland finde, dann werde ich die mal zur Sicherheit R. fibula taufen.

l.g.
Stefan
Hi Stefan
Eher nicht, aber mit etwas Erfahrung kann man R. mellea auch makroskopisch zu R. fibula unterscheiden, ist ehr so, dass zu wenig geschaut wird und zu schnell R. fibula angenommen wird. Ist in keinem Fall eine rein im alpine Brereich vorkommende Art.
 Siehe Links oben.
Siehe Links oben.VG Jo
-
Allerdings ist die Art im nicht-alpinen Raum sehr selten, die Wahrscheinlichkeit ist also sehr gross dass man dort die häufige Rickenella fibula in der Hand hat.
Gruss Raphael
Hi Raphael,
Nö, ist am Niederrhein häufig. In den passenden Biotopen ( Binnendünen, Trockenrasen etc) eigentlich immer vorhanden. Wird eben nur oft übersehen und für eine ausgeblaßte R. fibula gehalten.
Ein Blick in Mykis oder im Verspreidingsatlas.nl zeigt auch eindeutig, dass Rickenella mellea im Tiefland am meisten verbreitet ist.
Verbreitung Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure 1979
NMV Verspreidingsatlas | Rickenella mellea - Honingkleurig trechtertje
VG Jo
-
Alles anzeigen
Hi,
Ja sogar jede Menge, die findet man im Flachland allenfalls hoch im Norden. Diese Arten bilden z.B. Mykorrhiza mit Pflanzen, die es nur über der Baumgrenze gibt.
Natürlich gibt es auch viele Arten die planar bis alpin überall vorkommen. Die würde ich auch nicht ausschliessen in dem Spezialforum.
Gruss Raphael
Hi Raphael,
Damit würde es aber meiner Meinung nach verwässert. Leider sind jetzt schon viele Arten als montan beschrieben, die man auch am Niederrhein findet.
VG Jo
-
Hi Raphael,
gibt es überhaupt rein montane oder alpine Arten? Ist ja nicht so, dass im Flachland auch Arten findet, die lt Beschreibung Montan sein sollten.

VG Jo
-
Hi,
mit dem Gedanken sich ein Laowa zuzulegen haben viele gespielt und sich dann wegen der fehlende automatischen Fokussierung dagegen entschieden.
Werde mir demnächst den Aufbau zulegen
Traumflieger Makro Snapset - Traumflieger
nicht mit dem Mikroskopobjektiv, da gibt es bessere.

Weiterhin bracketing der Kamera möglich, aber je nach Mikroskopobjektiv bis 10:1.
VG Jo -
Hi Lars,
als erstes würde ich darauf achten, dass die Kamera bracketing beherrscht, damit wäre das Problem der Tiefenschärfe schonmal erl.
Für Pilze ala Steinpilz oder Fliegenpilz reicht ein normales lichtstarkes 50mm, geht natürlich auch mit einem Tele mit Zwischring, wenn man eigentlich nicht auf Pilztour ist. Es gibt aber auch sehr gut Makroobjektiv mit 50mm Brennweite. Ein Makro im 100er Bereich ist für Insekten und Schmetterling besser einsetzbar, kann aber auch natürlich für Pilzfotografie verwendet werden. Zwischenringe und Vorsatzlinsen gehören auch zur Ausrüstung, Beleuchtungspanelen oder Taschenlampe zur Ergänzung.
Zur Blende - Wie immer je lichtstärker um so besser, besonders wenn man outdoor fotografiert.
PS Falls es rein für die Pilzfotografie ist würde ich pers - und viel andere auch - eher MFT emfehlen. Weniger zu schleppen und eine andere Preisklasse, besonders bei den Objektiven....
Eine Option wäre auch Ausrüstung vorab zu leihen, um zu sehen womit man besser zurecht kommt (50-100mm)
VG Jo
-
Hi Christoph,
lt Auskunft von Irmgard Greilhuber bei European Boletes werden einige Arten aus dem Komplex macro- und mikroskopisch unterscheidbar sein. Schön ist es, daß auch ein Key inc Chalciporus hypochryseus dabei sein wird. Auch bei der vorgestellten Art Chalciporus pseudopiperatus ist ja ein Widerspruch in der Beschreibung

"Die Art kann nur mit Hilfe der Sequenzierung eindeutig identifiziert werden. Dieser dem eigentlichen Pfefferröhling täuschend ähnlich schauende Röhrling ist vor allem durch die jung gelben Röhren und Poren und das Blauen gekennzeichnet. Die seltene, jedoch beim Typus augenscheinliche Blauverfärbung ist sehr variabel, bisweilen sind die Röhren auch schmutzig rosa/bräunlich-rostig verfärbend, mit teil-weise ockerbleibenden Teilen, ohne jede Blautöne. Auch bei Vergleichen mit den Abbildungen von ROSTKOVIUS (1844), der oft Arten mit abweichenden Merkmalen darstellt,konnte kein ähnlicher Pilz aufgefunden werden. "
VG Jo
-
Hi Brigitte,
leider kann man auf den Fotos wenig erkennen. Einen sehr guter Vergleich mit seinem Verwechslungspartner =>
VG Jo
-
Hi,
wenn man Chaga, wie in Russland üblich, im Frühjahr erntet (zur Zeit, wenn auch das Birkenwasser gezapft wird) kann man ihn auch mit einem gezielten Wurf mit einem Stein oder Ast runterholen. Wobei deiner, vom Foto her, für mich zu klein wäre, um ihn jetzt schon zu entfernen.
VG Jo
-
Hi
An der Lamprospora hispanica habe ich dennoch meine Zweifel, Björn.
Nach Eckstein sollten die Sporen kleiner (14-16 µm) und zudem gröber ornamentiert sein
Eckstein schreibt aber auch, dass in der Orginalbeschreibung die Sporen größer sind.
"
Beim Vergleich mit der Originalbeschreibung von L. hispanica (Benkert 1987) zeigen sich nur wenige Unterschiede. Benkert (1987) beschreibt die Apothecien „mit deut-lichem häutigem Rand aus Textura porrecta“, während die deutschen Funde nur in wenigen Fällen einen schmalen, oft aber gar keinen häutigen Rand zeigen. Auch die Sporengröße inklusive Ornament wird von Benkert (1987) mit (15-)16-18(-19) μm etwas größer angegeben als die (13,5-)14-16 μm bei den hier vorgestellten Funden. "
Wobei seine Funde eher die Sporengröße von Lamprospora seaveri haben...
Orginalbeschreibung
Seite 227
https://www.dgfm-ev.de/publika…ospora-pezizales/download
VG Jo
-
LAF im Eigenbau? Wäre spannend
Viele Grüße
Ralph
Hi Ralph,
Auf der Seite hast Du auch eine Bauanleitung - Kosten ca 300€
Im Netz findet man natürlich auch mehr Infos.

VG Jo
-
-
Falls es Nadelholz (Pinus) war, dann könnte der orange Schleimpilz noch etwas anderes als Dictydiaethalium plumbeum sein: nämlich Enteridium (Reticularia) olivaceum. Falls man reife Fruchtkörper hat, läßt sich die Art sehr leicht bestimmen durch die Sporen, welche Klumpen bilden und dadurch kreiselförmig sind.
LG Ulla
Hi Ulla,
danke für den Tipp, den kannte ich nicht. Schätze Du liegt richtig, leider habe ich es nicht geschafft nochmal vorbei zufahren, aber bei der niederländischen Tour würde Enteridium olivaceum auch kartiert.
VG Jo