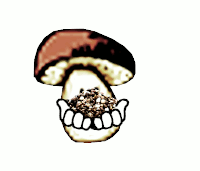Hi,
Bei meinem letzten ÖMG-Vortrag hatte ich die Idee, dass ich einen Vortrag über Umweltkontaminanten, wie z.B. Dioxine halten könnte. Die Idee fand großen Anklang. Ich müsste den erst Mal vorbereiten. Wenn er aber dann fertig ist, dann wollte ich den gerne als Generalprobe halten.
Die Frage ist, ob euch so was auch interessiert.
l.g.
Stefan