Willkommen in Teil 41 der Forumsreihe „QGIS für Pilzfreunde“!
Dieser Beitrag entstand mit QGIS 3.16 unter Windows 10.
Hier die Übersicht über alle Teile dieser Forumsreihe.
Heutiges Ziel:
Wir wollen die im NSG-1937 gefundenen Mykorrhizapilze herausarbeiten
Die Vorgehensweise im Einzelnen (verwendete QGIS-Werkzeuge)
- Die Tabelle aller Funde platzieren (Attributtabelle)
- Funde mit mit mykorrhizischer Lebensweise selektieren (Ausdrucks-Editor für SQL-Ausdrücke)
- Shapefile-Layer der selektierten Funde generieren (Shapefile-Export)
- Verschneiden der selektierten Funde mit dem nsg_1937 (Verschneidung)
- Eigenschaften der Funde anzeigen (Identifikationsergebnis und Attributtabelle)
Los geht's:
1. Die Tabelle aller Funde platzieren (Attributtabelle)
Bild 1 zeigt die Ausgangssituation. Unten rechts wird als KBS EPSG:25832 = ETRS89 / UTM-Zone32N eingestellt.
Via Layerfenster (links) ist im Kartenfenster Folgendes dargestellt:
- der Rundweg (violett), der Zugangsweg (blau), die Straße (rechts oben, schwarz)
- die Funde (schwarze Punkte)
- das Naturschutzgebiet seit 1937 nsg_1937 (schraffierte, schwarz umrandete Fläche).
Durch einen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von Attributtabelle öffnen öffnen wir die Attributtabelle aller Funde und ordnen sie ganz unten an, wie es Bild 2 zeigt.
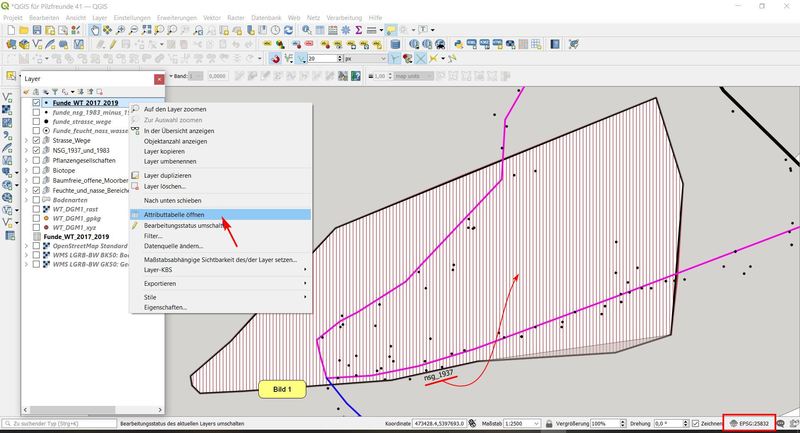
Die Spalte lebensw gibt die Lebensweise der einzelnen Pilzart wieder:
- myk = mykorrhizisch
- lig = lignikol
- etc.
2. Funde mit mit mykorrhizischer Lebensweise selektieren (Ausdrucks-Editor für SQL-Ausdrücke)
Um den Ausdrucks-Editor zu öffnen, clicken wir in der Menüzeile der Attributtabelle auf den Button mit dem Epsolon (Objekte über Ausdruck wählen):
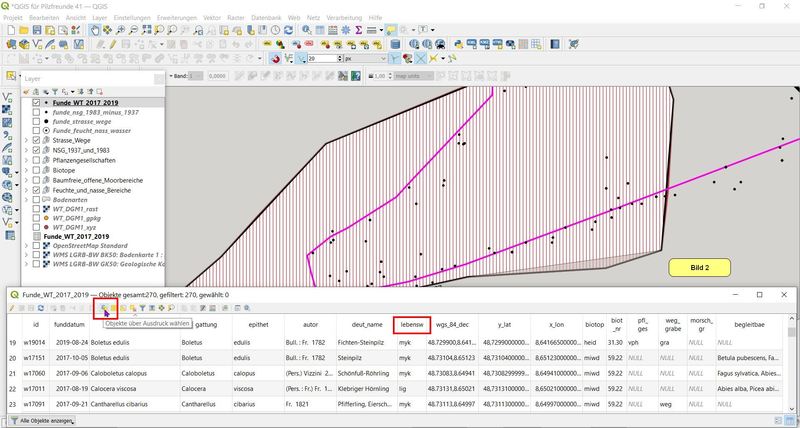
Die Bilder 3 bis 5 zeigen, wie man in diesem Menü einen mathematischen Ausdruck (SQL-Ausdruck) durch einfaches Clicken in den entsprechenden Menüfenstern zusammenstellt:
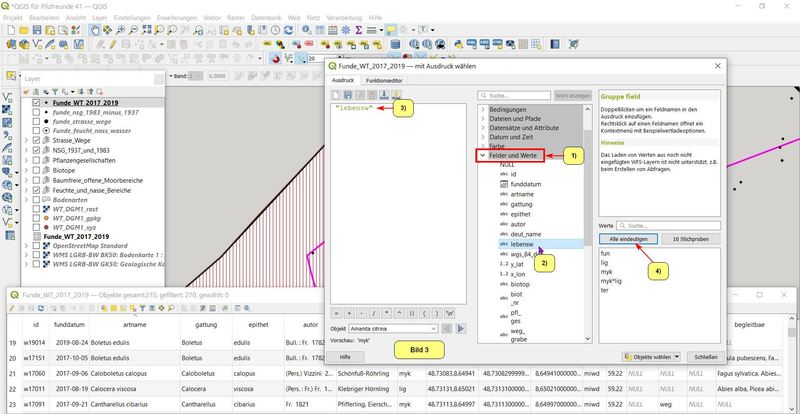
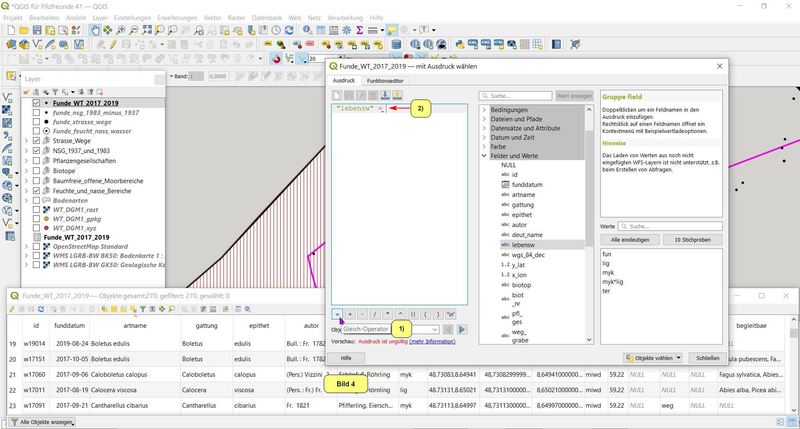
Da wir alle Funde mit mykorrhizischer Lebensweise haben wollen, lautet der Ausdruck "lebensw" = 'myk'.
Man beachte, dass die Kategorie in doppelten und der Wert in einfachen Hochkommata angegeben wird:
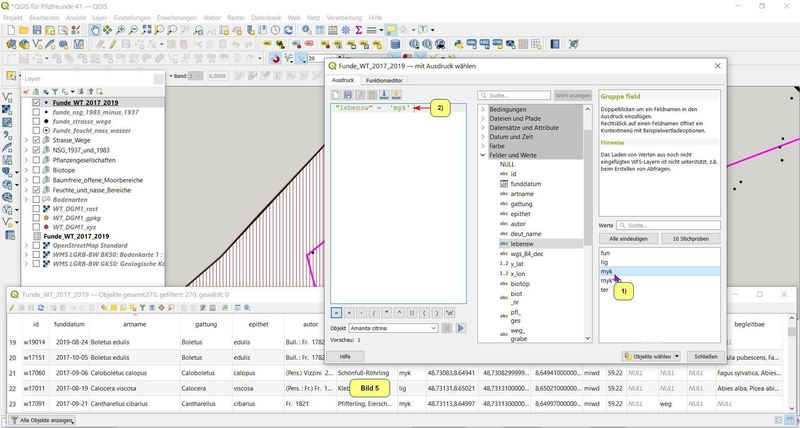
Sobald man den Button Objekte wählen clickt (1), geschieht zweierlei (Bild 6
- Im Kartenfenster nehmen die selektierten Funde eine andere Farbe an (hier gelb)
- In der Attributtabelle werden die Zeilen der selektierten Funde gehighlightet (hier blau):
Wir können nun das Menü schließen (3).
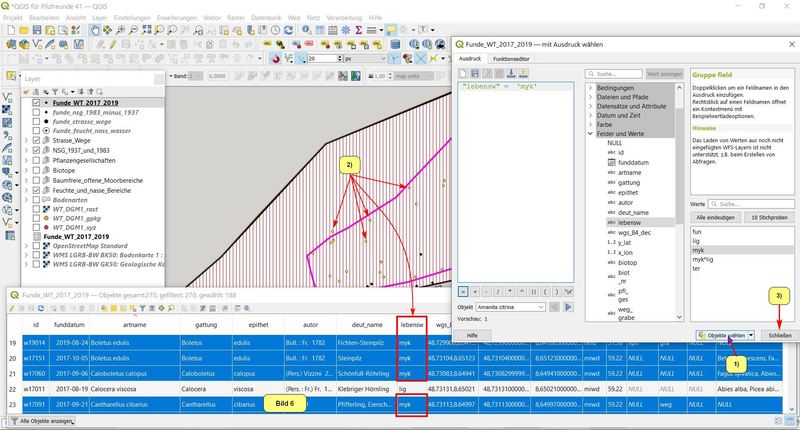
3. Shapefile-Layer der selektierten Funde generieren (Shapefile-Export)
Durch einen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von zur Auswahl zoomen beschränken wir den Kartenfenster-Ausschnitt auf den Bereich der Selektion:

Durch nochmaligen Rechtsclick im Layerfenster auf Funde_WT_2017_2019 und Selektion von Exportieren > Gewählte Objekte speichern als... speichern wir die selektierten Funde (Mykorrhizapilze) als Shapefile im dafür vorgesehenen Ordner ab Bilder 8 bis 11). Dabei müssen wir darauf achten, dass die entsprechenden Parameter angehakt sind:
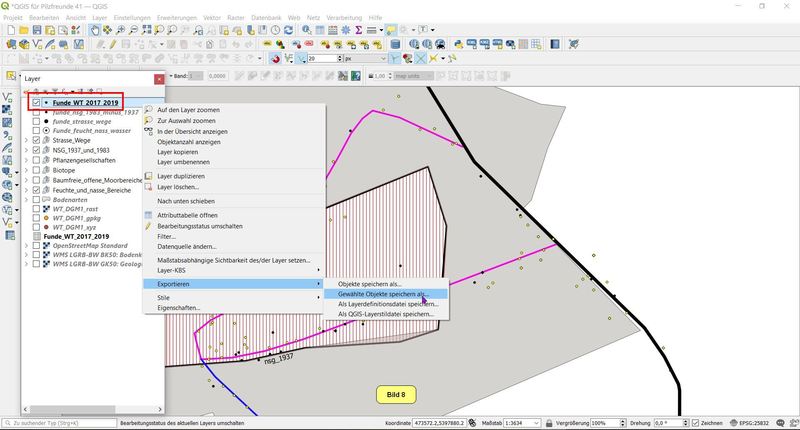
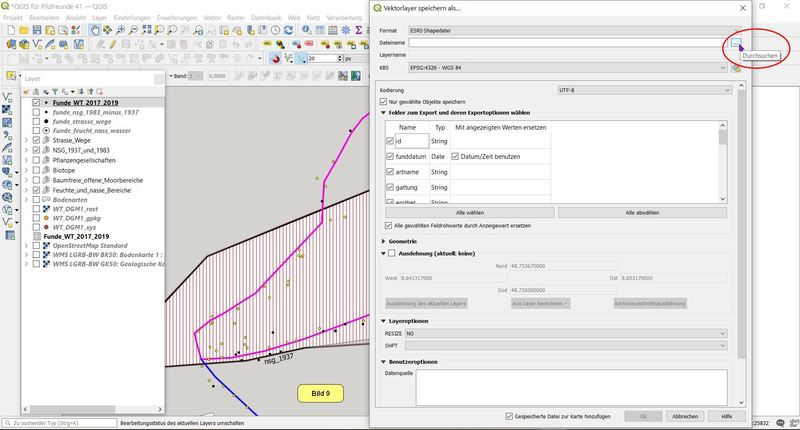


Es ergibt sich der neue Layer mykorrhiza_pilze, den wir im Layerfenster durch Anclicken selektieren durch einen Haken sichtbar machen. Wir öffnen seine Attributtabelle, in der wir ablesen können, dass sie 188 Funde enthält, das sind sämtliche Funde mit mykorrhizischer Lebensweise des gesamten Moorbereichs sowie des angrenzenden Moorrandwaldes:
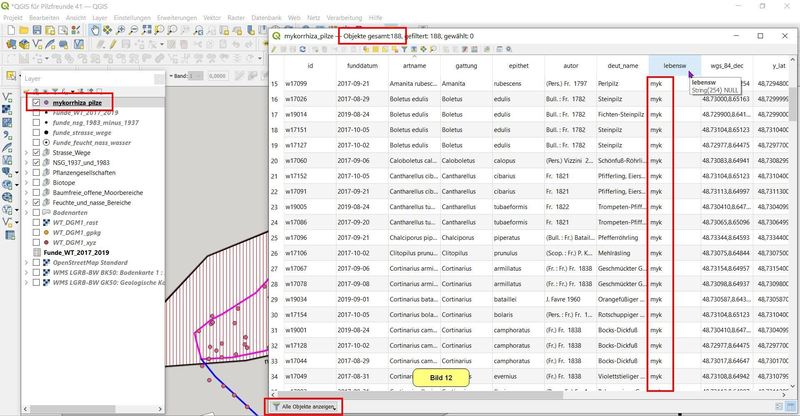
4. Verschneiden der selektierten Funde mit dem nsg_1937 (Verschneidung)
Auf das Verschneiden-Werkzeug wurde bereits in Teil 39 ausführlich eingegangen.
Deshalb möchte ich hier den Vorgang nur als Bilderfolge zeigen (Bilder 13 bis 17


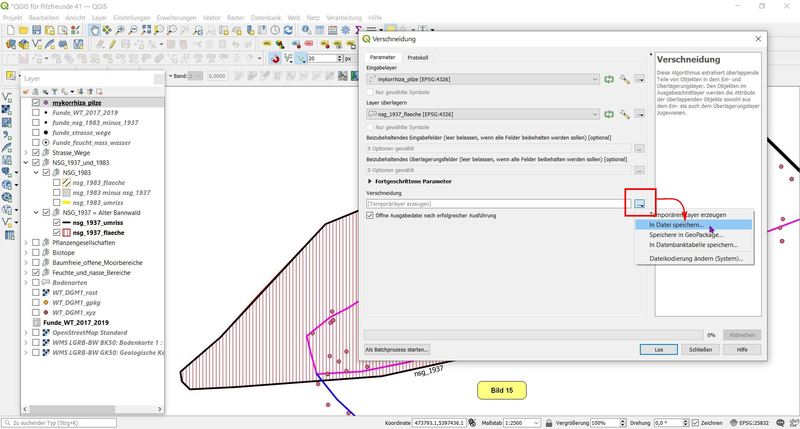


Als Ergebnis erkennen wir im Layerfenster den neuen Layer mykorrh_pilze_nsg_1937 und im Kartenfenster die zugehörigen Objekte in Form gelber Punkte innerhalb der nsg_1937-Fläche. (Da der Haken bei mykorrhiza_pilze noch vorhanden ist, sieht man auch noch Punkte außerhalb des nsg_1937.)

5. Eigenschaften der Funde anzeigen (Identifikationsergebnis und Attributtabelle)
Wir entfernen im Layerfenster den Haken bei mykorrhiza_pilze und erhalten nur die Mykorrhize-Pilze im nsg_1937.
Zur Kontrolle clicken wir auf den i-Button = Objekte abfragen (1) und dann auf einen beliebigen Punkt im Kartenfenster. Daraufhin öffnet sich das Identifikationsergebnis-Fenster mit sämtlichen Angaben über diesen speziellen Fund:

Nun öffnen wir zum Abschluss die Attributtabelle unseres neuen Layers und erkennen, dass es sich um 80 Mykorrhizapilz-Funde innerhalb des nsg_1937 handelt:
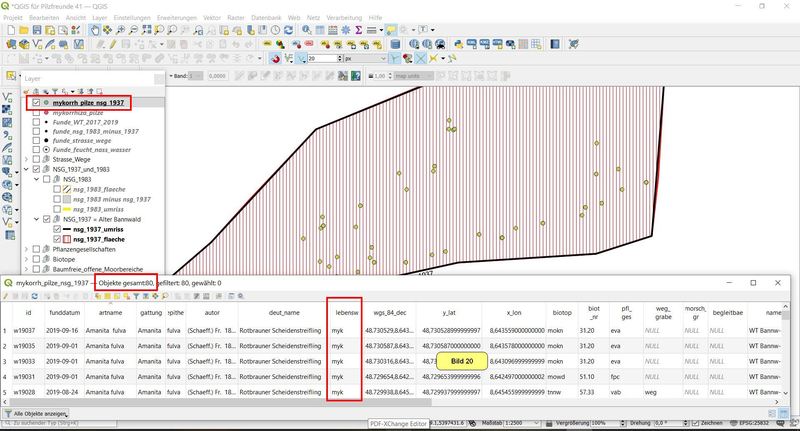
Wichtige Notizen
Das war's für heute!
Viel Freude beim Anschauen! 
Bernd
Meine Ausrüstung vor Ort
Android-Smartphone Moto G7 Plus mit folgenden, für die Kartierung benutzten Komponenten:
-
MeinePilze - Pilzbestimmungs-App zum Erstellen der Fundlisten etc. Die Funde sind automatisch georeferenziert.
-
Locus Map - GPS-App zur Darstellung des Kartierungsgebietes mit sämtlichen Pflanzengesellschaften, Biotopen, Tracks, Wegpunkten. Außerdem zur Erstellung von Tracks und georeferenzierten Fotos.
Literatur
Dierßen, B. & K. Dierßen (1984): Vegetation und Flora der Schwarzwaldmoore.‑ Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.‑Württ., 39: 1‑512
Dierßen, K. (1990): Einführung in die Pflanzensoziologie (Vegetationskunde)
Grossmann, A. (1985): Die Höheren Pflanzen und Moose des Bannwaldes Waldmoor-Torfstich, ihre Vergesellschaftung und ihre Standorte. In: Der Bannwald "Waldmoor‑Torfstich".‑ Mitt. forstl. Versuchs‑ und Forschungsanstalt Bad.‑Württ., "Reihe Waldschutzgebiete", 3: 29-51
HAAS, H. & G. KOST (1985): Basidiomycetenflora des Bannwaldes "Waldmoor-Torfstich". In: Der Bannwald "Waldmoor‑Torfstich".‑ Mitt. forstl. Versuchs‑ und Forschungsanstalt Bad.‑Württ., Reihe Waldschutzgebiete, 3: 105-123
Oberdorfer, E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil I: Fels- und Mauergesellschaften, alpine Fluren, Wasser-, Verlandungs- und Moorgesellschaften.
Oberdorfer, E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil IV: Wälder und Gebüsche
Glossar, Abürzungen
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
Biotop - Charakteristischer Lebensraum in der Natur mit Tieren, Pflanzen und Pilzen
Bulte - Über dem Wasserspiegel zeitweise überschwemmter Moorbereiche (Hoch- und Übergangsmoore) herausragende Erhebungen. Sie sind mit Moosen
(Polytrichum, Sphagnum), Wollgräsern (Eriophorum).und/oder Moosbeeren (Oxycoccus) bewachsen.
BW – Baden-Württemberg
Canvas - Fenster; Landkarte; Anzeige; Leinwand; Kartenfenster
CSV - Comma Separated Values; einfach strukturierte Textdatei
DGFM - Deutsche Ges. für Mykologie
DGM – Digitales Gekändemodell, Gebäude und Bewuchs sind eliminiert
DGMx - Digitales Geländemodell mit x Metern Gitterweite
DHDN - Deutsches Hauptdreiecks-Netz; Bessel-Ellipsoid mit dem Zentralpunkt Rauenberg; geodätisches Bezugssystetem "Datum" Potsdam
DOM – Digitales Oberflächenmodell
EPSG - European Petroleum Survey Group Geodesy
ETRS89 / UTM (Universal transverse Mercator) - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, d.h. geeignet zum Messen von Strecken und Flächen kleinerer Areale, z.B. Strecken- und Flächenmessungen in Größenordnungen, die durch die topografischen Karten 1:25000, 1:50000, 1:100000 abgedeckt sind
Fazies - Aspektwechsel innerhalb gleichartiger Bestände (Dierßen 1990)
Feature-Layer (Eigenschaften-Layer) - Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer (Flächen-Layer)
Gauss-Krüger - Flächengetreues KBS in der Einheit Meter, allerdings inzwischen vielfach durch ETRS89 / UTM ersetzt worden
Geodäsie - Wissenschaft von der Vermessung der Erdoberfläche
Geografische Koordinaten - Sie beschreiben einen geografischen Punkt auf der Erdoberfläche in Grad (z.B. in Grad/Minuten/Sekunden oder Grad mit Nachkommastellen)
Georeferenzierung (Geocodierung, Verortung, Geotagging) - Einen Datensatz, z.B. ein Foto oder eine Karte, mit Koordinaten versehen
GIS – Geoinformationssystem
GNSS - Global Navigation Satellite System
Google Maps - Online-Kartendienst
von Google LLC
GPX (GPS eXchange Format) – für
Datenaustausch mit GPS-Empfängern
GRASS - Geographic Resources Analysis Support System
HTML - Hypertext Markup Language
KBS - Koordinatenbezugssystem
Koordinatenbezugssysteme - Sie bestehen immer aus der Paarung Geodätischen Bezugssystem ("Datum") und dem Koordinatensystem, getrennt durch Schrägstrich. Gebräuchliche KBS:
- DHDN / 3GK = Datum Potsdam / 3 Grad Streifensystem Gauss-Krüger
- WGS84 / Lat-Lon = WGS84-Datum / Breitengrad-Längengrad
-
ETRS89 / UTM = ETRS89-Datum / UTM-Koordinatensystem
KML (Keyhole Markup Language) - Austauschformat für Geodaten, vorgesehen für Google Earth (aber auch für GPS-Empfänger nutzbar)
KMZ - dasselbe wie KML, lediglich in komprimierter Form
Layer - Ebene
Lidar (Light Detection And Ranging) – Laser-Scan der Geländeoberfläche
LiMT – Linke Maustaste
LUBW - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Map Canvas - Kartenfenster, also der Bereich, in dem die Karte angezeigt wird
m.ü.NN. - Meter über Normal Null
Multipolygon - Wenn die Objekte keine gemeinsame Grenze haben, wird ein Multipolygon-/Multipolylinien-/Multipunktobjekt erzeugt.
NSG, nsg - Naturschutzgebiet
ONB - Obere Naturschutzbehörde
Open Data – Für jedermann frei
nutzbar zur Verfügung gestellte Daten
OSM – OpenStreetMap
Passpunkte – Referenzpunkte beim Georeferenzieren von Karten
PflGes - Pflanzengesellschaft
Plugins - Programmerweiterungen
Projektbereich - Gesamtbereich des QGIS-Projektes im Rechner, beinhaltet das gesamte "Ordnergebäude" inklusive der Projektdateien und aller Daten; hier in der Forumsreihe ist es der Ordner \_QGIS für Pilzfreunde\ mit sämtlichen Unterordnern und Dateien. Will man ein QGIS-Projekt auf einem anderen Rechner laufen lassen, so braucht man lediglich den Projektbereich zu kopieren!
Projektdatei - Datei mit Endung .qgs, über die QGIS gestartet wird. Sie enthält die Projekteigenschaften, die Verknüpfungen zu den im Projekt enthaltenen Layern und vieles mehr. Sie enthält jedoch nicht die Daten
Projiziertes KBS - entsteht durch Kartenprojektion in die Ebene. Beispiele UTM, Gauss-Krüger. Zum Messen geeignet.
QGIS – Kostenfreies, sehr mächtiges
GIS
Pflanzengesellschaft - Spezifische Gruppe von Pflanzen mit gleichen ökolog. Ansprüchen und mit Wechselbeziehungen zueinander
ReMT – Rechte Maustaste
Rasterlayer - Layer, bestehend aus bildhaften, pixelcodierten Geodaten.
Schummerung – Pseudo-3D-Darstellung
durch Schattenwurf.
SQL - Structured Query Language, Sprache für Datenbankstrukturen
SQL-Abfrage (SQL Query) - Wird in QGIS mit Hilfe des Abfrage-Editors erzeugt
Shape, Shapefile - Datei zum Darstellen von Punkten, Linien und Polygonen (Flächen).
Tiles – Karten in Form sogenannter
„Kacheln“.
URL – ein Internet-Link oder die Adresse
einer Website.
Vektorlayer - Layer, bestehend aus vektorcodierten Geodaten, d.h. aus Punkten, Linien und Polygonen (Flächen).
UTM - Universal Transverse Mercator-Koordinatensystem, siehe ETRS89.
Vektorlayer - Layer, bestehend aus vektorcodierten Geodaten, d.h. aus Punkten, Linien und Polygonen (Flächen)
Verschneidung - Überlagerung von zwei oder mehr Layern. Das Ergebnis beinhaltet sozusagen die Gemeinsamkeiten der Eingabelayer.
WFS - Web Feature Service
WGS84 - World Geodetic System 1984. Meistbenutztes Bezugssystem für geografische Koordinaten.
WGS 84 EPSG:4326 – globales KBS, bei
GPS-Empfängern verbreitet, nicht zum Messen geeignet
WGS 84/ Pseudo-Mercator EPSG:3857 – globales
KBS für WMS-Einbindungen, nicht zum Messen geeignet
WMS (Web Map Service) –
Internet-Schnittstelle für Landkarten


